| [ Zurück ] [ 7. Deutsches Kinder- und Jugendtheater-Treffen ] |
| |
|||
|
|
Augenblick mal !
|
|
|
WAS, WIE, WO? |
||
|
Goethe-Institut Inter Nationes (GI) |
||
|
Treffpunkt |
||
|
Die Auswahlkommission |
||
|
Russische Gastspiele |
||
|
Rahmenprogramm |
||
|
Dokumentation |
||
|
Der Augenfüssler |
||
|
Theater Jugend Medien |
||
|
Quellennachweis |
||
| |
||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fragen, Unklarheiten, Nöte? Kommen Sie zu uns. Am Festivalschalter im unteren Foyer des carrousel Theaters halten wir alles bereit, was während eines Festivals benötigt werden könnte. Mit Infos, Adressen, Zeitplänen, Tipps, Taschentüchern und Regenschirmen sind wir am Samstag, den 3. Mai, ab 15 Uhr, und an den weiteren Tagen von 9 bis 20 Uhr für Sie da. carrousel Theater an der Parkaue, unteres Foyer |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Fotografie & Tonaufnahmen |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Das Filmen und Fotografieren während der Veranstaltungen ist nicht erlaubt. Das Kinder- und Jugendtheaterzentrum hat jedoch einzelne Fotografen beauftragt, das 7. Deutsche Kinder- und Jugendtheater-Treffen in Ton und Bild aufzunehmen, um hieraus wie in den vergangenen Jahren auch eine Dokumentation des Festivals zu erstellen. Neben dem eigentlichen Zielpublikum, den jugendlichen Zuschauern der Aufführungen, wendet sich Augenblick mal! auch an das Theaterfachpublikum, das über die Dokumentation Gelegenheit bekommen, sich mit den gezeigten Inszenierungen und den stattgefundenen Diskussionen und Arbeitsforen auseinander zu setzen und die Diskussion um das Kinder- und Jugendtheater gemeinsam fort zu setzen. Für mögliche Störungen durch die Fotografen bitten wir das Publikum um Nachsicht. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Essen & Trinken |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Im Festivalzelt, unter Bäumen im Stadtpark direkt neben dem carrousel Theater gelegen, wird es rund um die Veranstaltungen im carrousel Theater und in der Hochschule Ernst Busch, Abteilung Puppenspielkunst, Getränke und Speisen geben. Hier kann man sich ausruhen und stärken und andere Festivalteilnehmerinnen und -teilnehmer treffen. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Die Spielorte |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Das Carrousel Theater an der Parkaue Seit 1950 besteht Deutschlands größtes Kinder- und Jugendtheater. Das frühere Jungengymnasium (erbaut 1911) wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in einen Kulturstandort umgewidmet. Im rechten Teil des Gebäudetraktes entstand aus der alten Schulaula im 3. Stock ein Theatersaal. Dafür wurde einer der größten Bühnentürme der Stadt angebaut (35 m). Die Hauptbühne (12 m Tiefe, 7 m sichtbare Breite) ist mit einer Drehscheibe (10 m Durchmesser) ausgestattet, der Zuschauerraum bietet bis zu 430 Besuchern Platz. Die in den 70er Jahren erbaute Probebühne auf dem hinteren Teil des Geländes dient seit Anfang der 80er Jahre als weitere Spielstätte. Auch sie ist mit einer Drehscheibe ausgestattet und fasst bei variabler Bestuhlung rund 67 Zuschauer. Seit 2001 steht außerdem noch die ehemalige Turnhalle als neuer Spielort, ebenfalls mit variabler Bestuhlung, zur Verfügung. In der linken Gebäudehälfte entstand das Haus der Kinder mit Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Heute werden diese Räumlichkeiten von der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Abteilung Puppenspielkunst, genutzt. Seit diesem Jahr hat hier im ehemaligen Kinosaal Das Weite Theater seine Spielstätte. Das GRIPS Theater Im Jahr 1956 wurde im Rahmen der internationalen Bauausstellung der gesamte Hansaplatz in Berlin neu bebaut, darunter auch das Gebäude des GRIPS Theaters, das zunächst das Bellevue-Kino beherbergte. Die damalige GRIPS-Crew wurde 1974 auf das mittlerweile leer stehende Gebäude aufmerksam, für das jedoch der Supermarkt Aldi schon einen Mietvertrag hatte. Volker Ludwig konnte Aldi überreden, den Raum gegen einen anderen zu tauschen, und so übernahm er selbst den Mietvertrag, nicht ohne als Sicherheit alle seine Autoren-Tantiemen bis 70 Jahre nach seinem Tod zu verpfänden. Die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin und der Senat unterstützten den Umbau in eine Arena-Bühne und am 30.9.1974 wurde das GRIPS Theater am Hansaplatz eröffnet. Genau 20 Jahre später wurde das Theater mit Lotto-Mitteln nochmals umgebaut. Die von Jahr zu Jahr katastrophaleren Zustände, unter denen die mehr als 50 Mitarbeiter in einem ehemaligen Kino ohne Nebenräume ein Ensemble- und Repertoire-Theater zu betreiben versuchten, hatten ein Ende. 1995 wurden ein Bürotrakt, Magazine und ein Probenraum neu bezogen. 1998 verkaufte der Grundstückseigentümer die GRIPS-Gebäude an die Fundus-Gruppe. Mit ihr hat das GRIPS Theater einen neuen Mietvertrag über 20 Jahre geschlossen. Die Schiller Theater Werkstatt Nachdem die Staatlichen Schauspielbühnen Berlin 1994 vom Senat geschlossen worden sind und die Schiller Theater Werkstatt ein Jahr lang leer gestanden hatte, wurde sie 1995 dem GRIPS Theater und dem carrousel Theater als Bühne zur Verfügung gestellt. Aufgrund von Sparmaßnahmen hat der Senat für Wissenschaft, Forschung und Kultur dem carrousel Theater die Nutzung der Schiller Theater Werkstatt ab Ende der Spielzeit 2000/2001 untersagt. Seit diesem Jahr bespielt das GRIPS Theater die Werkstatt alleine. Der Spielort hat 90 Zuschauerplätze. Seit 2002 ist es möglich, zwischen zwei Tribünen vor 135 Zuschauern zu spielen. Die SCHAUBUDE Puppentheater Berlin Das Gebäude, das heute in der Greifswalder Straße die SCHAUBUDE beherbergt, wurde 1929 als Teil eines Kaufhauses jüdischer Eigentümer erbaut. Seine Geschichte ist folglich so wechselhaft wie das vieler Häuser Ostberlins, die heute mit ihren beinahe ein Jahrhundert alten, verletzten Fassaden neben den blitzblanken neuen stehen bereit zu erzählen... An das einstige Kaufhaus erinnern nur noch die Schaufenster. Jahrelang verbaut, verhüllt, zugehängt, hat die SCHAUBUDE die großen Glasflächen wieder geöffnet, um sie das sein zu lassen, wozu sie bestimmt waren: SCHAU-Fenster, die den Blick frei geben, nach innen und nach außen, die das Geschehen in diesem Theater jederzeit öffentlich machen. In diesem Theater begegnen sie sich einander - die Kinder, die Jugendlichen und die Erwachsenen, entdecken die ihnen oft so unbekannte Welt des Theaters der Puppen, Figuren, Objekte oder Dinge. Theater der Dinge ist auch der Titel des internationalen Objekttheaterfestivals, das die SCHAUBUDE in Kooperation mit der Akademie der Künste, dem Kesselhaus in der Kulturbrauerei und den Sophiensælen, gefördert vom Hauptstadt Kulturfonds vom 15. bis 22. Mai 2003 veranstaltet, und zu dem jeder Zuschauer ob Kind oder Erwachsener herzlich willkommen ist. Die Kultur Brauerei Das Kesselhaus in der Kulturbrauerei hat sich im Lauf der letzten zehn Jahre zu einem wichtigen Veranstaltungsort Berlins entwickelt. Vor dem Hintergrund einer wechselhaften Geschichte und eingebettet in den sorgfältig restaurierten, denkmalgeschützten Architekturkomplex der Kulturbrauerei ist das Kesselhaus ein kultureller Magnet in der Mitte des Prenzlauer Bergs. Der seit seiner Nutzung als Kesselhaus der Bierbrauerei nahezu unveränderte Saal hat einen industriellen Charme, der eine atmosphärische Plattform für unterschiedliche Veranstaltungen bietet: Festivals, Konzerte, Lesungen, Opern, Tanz- und Theater-Veranstaltungen sowie Clubreihen mit verschiedenen Schwerpunkten. Auch die Film- und Videoindustrie nutzt das Kesselhaus. Darüber hinaus finden hier regelmäßig Tagungen, Kongresse und Firmenevents statt. Ab Sommer 2003 wird das Kesselhaus umgebaut. Die Baumaßnahmen dienen in erster Linie der Verbesserung der Infrastruktur, wie zum Beispiel der Erweiterung der technischen Möglichkeiten und der Einrichtung eines Service- und Informationspoints. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen wird außerdem das Kleine Kesselhaus saniert, das vor allem Theater- und Kleinkunst-Inszenierungen Platz bieten soll, aufgrund seiner Multifunktionalität grundsätzlich aber auch anderen Veranstaltungstypen offen steht. Beide Veranstaltungsräume sind unabhängig voneinander bespielbar, können aber auch für gemeinsame Projekte genutzt werden. Die Arena Die arena wurde 1927 als Berlins Omnibushauptwerkstatt von Franz Ahrens erbaut. Mit 7000 qm ist sie zu dieser Zeit die größte freitragende Halle Europas. Sie fasste zu Zeiten des Omnibusbetriebes 240 Busse. Wie die meisten Industriebetriebe wurde der Betriebshof Treptow während des II. Weltkriegs von den Nationalsozialisten zweckentfremdet - hier wurden Panzer für die Wehrmacht gebaut und gewartet. Vom Krieg selbst wurde die arena weitgehend verschont und unmittelbar danach als Flüchtlingslager genutzt. Der gesamte Berliner Nahverkehr wird seit 1949 vom Hof T aus durch das Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe abgewickelt. Das Gelände befand sich nun unmittelbar am Mauerstreifen und war nur noch den Beschäftigten der Verkehrsbetriebe sowie den ständig anwesenden DDR-Grenztruppen zugänglich. 1993 schließt die wiedervereinigte BVG den Hof, um im Südosten von Berlin einen neuen Standort aufzubauen. Der 1995 gegründete ART Kombinat e.V. machte sich zum Ziel, den ehemaligen Betriebshof für die Durchführung kultureller Veranstaltungen zu nutzen. In der arena finden heute Veranstaltungen für bis zu 7500 Zuschauer statt Konzerte, Theater, Parties, Events und Messen. Im benachbarten Haus am Flutgraben wurde in der ehemaligen Dreherei das Glashaus eingerichtet als Club und Theater. Durch dieses Haus verlief der Todesstreifen in der Glasfront des Theaters wurden noch einige Glasziegel belassen, die Bestandteil der Berliner Mauer waren. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Rückblick & Ausblick |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Unter www.augenblickmal.de sowie jugendtheater.net können Sie sich über das aktuelle, aber auch über die vergangenen Kinder- und Jugendtheater-Treffen informieren und alles über die weiteren Veranstaltungen und Aktivitäten des Kinder- und Jugendtheaterzentrums in der Bundesrepublik Deutschland erfahren. Das 8. Deutsche Kinder- und Jugendtheater-Treffen wird im Frühjahr 2005 in Berlin stattfinden. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Im Ausland ist das Interesse an der lebendigen und künstlerisch anspruchsvollen deutschen Theaterszene nach wie vor sehr hoch. Längst können nicht alle sinnvollen Projekte unterstützt werden; deshalb konzentrieren wir uns bei der Auswahl auf solche, die durch ihre herausragende Qualität in der Lage sind, neue Impulse zu geben und den künstlerischen Austausch zwischen beiden Ländern nachhaltig zu fördern. Neben Projekten, die sich ausschließlich an ein Theaterfachpublikum richten, fördern wir auch Projekte dies vor allem im Bereich Kinder- und Jugendtheater die Deutschlernern in aller Welt die Mög-lichkeit geben, die deutsche Sprache im kulturellen Kontext live zu erleben. Theater fördert aufgrund seiner vielfältigen Ausdrucksformen das Verstehen und gleichzeitig wird ein Teil deutscher Kultur und Landes-kunde vermittelt. Häufig lassen sich auch die genannten Ziele gut miteinander verbinden. |
|
||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Projektbeispiele |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Wie man mit einem Projekt mehrere Ziele und verschiedene Zielgruppen erreicht, wird anhand des Berichts von Georgia Herlt (Leiterin der Spracharbeit des GI Kopenhagen) deutlich. Georgia Herlt hatte im Rahmen der GI Fortbildung zum 6. Deutschen Kinder- und Jugendtheater-Treffen in Berlin das schauspielhannover kennengelernt mit seiner nicht nur für Jugendliche sehr spannenden Inszenierung Creeps. Die Produktion wurde im Herbst 2001 nach Kopenhagen eingeladen und so entwickelte sich eine weitere Kooperation, die zu folgendem Projekt mit dem GI Kopenhagen führte: SCHAUSPIELHANNOVER: Goethes Werther! in Kopenhagen Gastspiel Nov. 2002, Theaterpädagogik als Vorbereitung auf das Gastspiel, Publikumsgespräche mit Regisseur und Schauspieler, Theatertagung für deutsche und dänische Regisseure und Fachleute Ist Theater für Schüler im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts überhaupt interessant? Und wenn ja, warum ein Stück wie Werther! für Deutschlerner und Deutschlehrer als Gastspiel nach Kopenhagen holen? Nicolas Stemanns Inszenierung eines alten Stoffes mit radikal modernen Mitteln gelingt es nicht nur, die Werther-Thematik im weitesten Sinne die Kämpfe Heranwachsender um die eigene physische und psychische Selbstfindung in die heutige Zeit zu übertragen, sie rüttelt darüber hinaus das Publikum auf und setzt beim Zuschauer ein Involviertsein in Gang, das so nur im Medium Theater zum Tragen kommen kann. Bei der Stemann-Inszenierung handelt es sich um ein einstündiges Ein-Personenstück mit Philipp Hochmair in der Rolle des Werther. Die Inszenierung hält sich einerseits in sehr gekürzter Form an den Originaltext, andererseits spielt der Einsatz moderner Medien vorwiegend die Videoübertragung eine tragende Rolle. Schüler sind im Allgemeinen mit dem Medium Theater in Dänemark relativ wenig vertraut. Ein Theaterbesuch allein kann da nicht viel bewirken. Um den Zugang zu erleichtern, wurden die Schüler im Vorfeld durch theaterpädagogische Veranstaltungen vorbereitet. Die Theaterpädagogin des schauspielhannover, Barbara Kantel, hat in der Woche vor den Gastspielaufführungen durch szenische Vorbereitung auf die Inszenierung ganze Schulklassen neugierig auf Theater gemacht und das ausschließlich mit den Mitteln des Theaters. Deutschlerner näherten sich in Übungen mit und ohne Text den Charakteren und Situationen aus dem Stück, lernten Besonderheiten der Inszenierung kennen und entwickelten so einen sehr persönlichen und gewissermaßen erfahrungsbezogenen Zugang als Zuschauer. Die dort erarbeiteten Standbilder der Schüler wurden dann als Videomitschnitte im Theaterfoyer vor jeder Vorführung gezeigt. Die theaterpädagogischen Annäherungen an Goethes Werther waren für die Schüler eine ihnen vollkommen neue Form des Deutschunterrichts, die sie und ihre Lehrer begeisterte denn sie setzten sich aktiv mit dem Thema Selbstverliebtheit und Verliebtsein auseinander und sie erarbeiteten diese Themen handlungsorientiert. Die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen, diese anderen mitzuteilen teils mit und teils ohne Sprache wirkte bei sprachlich Begabten ebenso wie bei weniger Begabten motivationsfördernd. Das Entdecken der eigenen Möglichkeiten nicht zuletzt in den Improvisationsübungen hat zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik beigetragen. Eine bereichernde Erfahrung für alle Beteiligten war die Vielzahl kulturell bedingter Reaktionen seitens der dänischen Schüler auf die Inhalte des Stückes. Ganz gleich wie der kulturelle Zugang auch aussah, in der Auswertungsrunde wurden von den allermeisten Teilnehmern zwei Dinge hervorgehoben: die bessere Kenntnis der Thematik des Stückes und der Spaß, den diese theaterpädagogischen Aktivitäten für sie selbst und ihren damit verbundenen Lernprozess mit sich brachten. Mit dem Theaterbesuch wurden die Hoffnungen auf eine interessante Inszenierung mehr als nur erfüllt. Auch wenn bei sprachlich schwächeren Schulklassen der Text nur in Ansätzen verstanden wurde, so war eine zumindest rudimentäre Kenntnis des Stückes Lehrer konnten sich beim Goethe-Institut ein Materialienpaket zur Vorbereitung bestellen ausreichend, um in dieser auch stark auf außersprachliche Komponenten ausgerichteten Inszenierung einiges zu verstehen. Dass eine von persönlichem Interesse geleitete Interpretation des Stückes angeregt worden war, zeigte sich am besten in den Fragen der Schüler bei den Gesprächen zwischen Publikum und Schauspieler und Publikum und Regisseur. Neben dem Publikum aus den Schulen und Theaterinteressierten besuchte eine ganze Reihe namhafter deutscher und dänischer Regisseure die Werther-Inszenierung. Sie waren in Kopenhagen zusammengekommen, um sich in einem Workshop über Theaterideen und Realitäten auszutauschen. Wer darüber hinaus noch eine weitere Perspektive auf Goethes Werther haben wollte, konnte sich im selben Monat in Kopenhagen dem Operngenre zuwenden und Massenets Oper von Goethes Werther in der Königlichen Oper in Kopenhagen in französischer Sprache erleben. Und wer dann noch immer nicht genug von Werther bekommen hatte, der konnte sich dem Original zuwenden: nämlich Werthers Echte Bonbons, von denen dem GI Kopenhagen tausende Bonbons vom Unternehmen Storck gesponsert wurden, um alle dänischen Wertherianer nicht nur geistig, sondern auch kulinarisch zu erfreuen. Puppentheater am Meininger Theater: Der standhafte Zinnsoldat in Brighton und Dublin Das Puppentheater am Meininger Theater präsentierte im Rahmen des Festivals visions 2002 das Stück Der standhafte Zinnsoldat in englischer Übersetzung. Alle Vorstellungen waren ausverkauft, britische Theaterexperten, Theaterkritiker und das Publikum waren begeistert. Im Anschluss an das Festival spielte das Puppentheater für Deutschlerner in Irland. Im Rahmen des Kinder- und Theaterfestivals 2002 in Suita/Osaka hielt Henning Fangauf, stellvertretender Leiter des Kinder- und Jugendtheaterzentrums in Frankfurt am Main, Vorträge zu den Themen: Kinder brauchen Theater Die Bühnenkunst für junge Zuschauer und Das Kinder- und Jugendtheater in Deutschland Strukturen, Finanzen und Spielpläne. Neben den Vorträgen diskutierte Henning Fangauf mit japanischen Theaterfachleuten und koordinierte mit ihnen in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut für 2003 geplante Veranstaltungen, u.a. auch das Gastspiel einer deutschen Kindertheatergruppe. Die Tradition der Beschickung des Internationalen Kindertheaterfestivals Sibenik mit einem Kindertheaterensemble aus Deutschland fortsetzend, konnte das Goethe-Institut Zagreb in diesem Jahr das Theater Waidspeicher Puppentheater Erfurt für ein Gastspiel gewinnen. Das Stück Fräulein Tong Tong oder verliebt, verlobt, verheiratet, ein kleines Schauspiel mit Live-Musik nach einer Idee von und mit Holger Friedrich begeisterte durch seine Harmonie zwischen Wort, Mimik, Gestik und Melodie des Wortes. Zwar enthält Fräulein Tong Tong relativ viel Text für ein Gastspiel im Ausland, doch ein Journalist der lokalen Fachpresse kommentierte Ich habe mit dieser Aufführung vom ersten bis zum letzten Augenblick kommuniziert, obgleich ich kein einziges Wort Deutsch kann. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Aufgaben |
|
||||||||||||||||||||||||||
Die erwähnten Projekte sind Beispiele aus der intensiven, lebendigen und immer dialogorientierten Theater- und Spracharbeit des Goethe-Instituts. Die Ziele und Aufgaben seien hier noch einmal stichwortartig zusammengestellt:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Neue Projekte |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Theaterprojekte des Goethe-Instituts entstehen in enger Kooperation der Institute im Ausland mit ihren Partnern vor Ort. Der Theaterbereich und der Bereich Kulturprogramme im Rahmen der Spracharbeit beraten die Institute bei der Auswahl geeigneter Künstler oder Inszenierungen. Der Beirat Theater, der sich aus namhaften Fachleuten aus den Bereichen Theater und Tanz, in dem auch die Bereiche Kinder- und Jugendtheater, Puppen- und Figurentheater durch Experten vertreten sind, ist das entscheidende Beratungsgremium für alle Theaterprojekte. Anträge auf Unterstützung eines Projektes im Ausland können ausschließlich von Goethe-Instituten oder Goethe-Zentren im Ausland gestellt werden. Eine direkte Bewerbung durch Künstler oder Ensembles um Auftritte oder Unterstützung eines Vorhabens ist leider nicht möglich. Das 7. Deutsche Kinder- und Jugendtheater-Treffen begreifen wir wieder als die einmalige Chance, Beispiele für die neuesten Entwicklungen im deutschen Kinder- und Jugendtheater konzentriert und intensiv zu erleben und mit TeilnehmerInnen und Theaterfachleuten Kontakte aufzubauen, fortzuführen oder zu intensivieren. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Festivaltreffpunkt ist das Theaterzelt neben dem carrousel Theater an der Parkaue. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ina Kindler-Popp Der Berufseinstieg als Theaterpädagogin erfolgte für Ina Kindler-Popp 1990 im Gründungsjahr der Freien Kammerspiele Magdeburg unter der Intendanz Wolf Bunges. Impulse erfuhr die Arbeit über das berufsbegleitende Studium an der Hoogeschool vor de Kunsten Utrecht, das 1996 abgeschlossen wurde. Seit 1995 erweiterten Regie- und Dramaturgiearbeiten im Rahmen des Kinder- und Jugendspielplans das Aufgabenfeld. Dem konzeptionellen Ansatz der Freien Kammerspiele folgend, Theaterkunst als Kommunikationsmittel unterschiedlichster Zielgruppen zu nutzen, entstand beispielsweise 1996 The Pipers ein Theaterprojekt mit behinderten Spielern, als Kooperationsmodell von Theater, Fachhochschule und Diakonie. Lehraufträge an der Fachhochschule und der Universität Magdeburg begleiteten die Arbeit langfristig. Der Intendantenwechsel im Jahr 2001 löste die berufliche Bindung in Magdeburg und bot der seit längerem geplanten Familienzusammenführung im Bayrischen eine Chance. Derzeit ist eine Publikation zum Thema Historisches Spiel als theaterpädagogische Methode in Vorbereitung. Außerdem realisieren sich auf freiberuflicher Basis theaterpädagogische Projekte mit Kindern und Jugendlichen, aktuell unter anderem in Kooperation mit den Münchner Kammerspielen. |
|
||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peter Fischer Peter Fischer, geboren 1953 in Görlitz, machte sein Abitur in Ostberlin, studierte am Institut für Lehrerbildung, Fachbereich Heimerziehung, und arbeitete zehn Jahre in einem Berliner Heim für familiengelöste Jugendliche. Ab 1983 arbeitete er als Assistent, dramaturgischer Mitarbeiter und Regisseur in Neustrelitz am Friedrich-Wolf-Theater und wiederholt als Gastdozent an der Hochschule für Schauspielkunst in Rostock. 1991 schloss er an der Humboldt-Universität zu Berlin ein externes Studium als Diplom-Philosoph ab. Am Dreisparten-Theater Nordhausen baute Peter Fischer unter der Intendanz von Michael Schindhelm 1992 ein integriertes Kinder- und Jugendtheater auf, als dessen künstlerischer Leiter er bis 1995 auch Festivals mobiler Aufführungen und das bundesweite Theatertreffen der Jugendclubs an Theatern veranstaltete. Seit 1995 ist Peter Fischer Intendant des Theater Waidspeicher, Puppentheater Erfurt und künstlerischer Leiter der Biennale Synergura, Internationales Puppentheaterfestival in Erfurt. Er ist seit 1996 Vorstandsmitglied des Deutschen Forums für Figurentheater und Puppenspielkunst in Bochum und Mitglied des Beirates Theater und Tanz beim Goethe-Institut Inter Nationes. |
|
||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Franziska Steiof Nach dem Studienabschluss arbeitete Franziska Steiof zunächst als Regieassistentin am Theater im Werftpark und am Schauspielhaus der Städtischen Bühnen Kiel. Seit 1991 ist sie freie Regisseurin. Sie inszenierte unter anderem am Werftparktheater Kiel, am GRIPS Theater Berlin, an der Landesbühne Wilhelmshaven und am MOKS am Bremer Theater. Mit der Gruppe Theater Triebwerk gab es Koproduktionen mit dem Staatstheater Oldenburg, Kampnagel Hamburg und dem Schauspielhaus Hamburg. 2002 war Franziska Steiof Mitbegründerin der freien Gruppe DeichArt, die inzwischen zwei Eigenproduktionen hervorgebracht hat. Sie ist als Dozentin unter anderem am Hamburger Schauspielstudio Frese sowie am Psychologisch-Theologischen Institut Hamburg und in der Theater- und Spiel-Ausbildung der Arbeitsgemeinschaft Spiel und Theater tätig. Als Autorin wird sie vom Theater- StückVerlag Korn-Wimmer vertreten. Ihre Inszenierung norway. today am Berliner GRIPS Theater war 2002 für den Friedrich-Luft-Preis nominiert. |
|
||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bericht der Auswahlkommision |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Was bedeuten zwei oder vier Jahre für die Entwicklung einer solchen Kunstform wie des Kinder- und Jugendtheaters? Welche neuen Entdeckungen erwarteten den Suchtrupp auf seinem Weg durch die Landschaft des deutschen Kinder- und Jugendtheaters? Was sind die Wegemarken, an denen man sich bereits orientieren kann? Wo sind noch Fragen offen geblieben bei unseren Kollegen, die in den Jahren zuvor als Auswahlkommissionen auf die Reise gegangen sind? Der sehr detaillierten Standortbeschreibung der Auswahlkommission des 6. Deutschen Kinder- und Jugendtheater-Treffens ist hinsichtlich des gewachsenen künstlerischen Selbstbewusstseins, der kulturpolitischen Akzeptanz, der Vielfalt der Inszenierungsstile und Spielplaninhalte und der effektiven Zielgruppenorientierung nichts grundsätzlich Neues hinzuzufügen, so dass wir, was das angeht, auf wiederholende Beschreibungen verzichten können und auf den Text unserer Kollegen verweisen möchten. Allerdings greifen wir drei offene Fragen unserer Kollegen von 1999 und 2001 auf. Wo finden Überschreitungen der Genregrenzen im Kinder- und Jugendtheater statt? Verpasst das Kinder- und Jugendtheater den Anschluss an die (virtuelle) Realität seines Publikums? Wie profitabel sind Kooperationen in der heutigen Theaterlandschaft |
|
||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Es wird neu gemischt oder: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hartmut Krug schrieb in seinem Bericht der Auswahlkommission für das 5. Deutsche Kinder- und Jugendtheater-Treffen 1999 in Berlin: Was noch zu selten stattfindet: die Genreüberschreitung. Tanz, Musik, Pantomime und Sprechtheater, sie verschmelzen noch kaum in Inszenierungen des Kinder- und Jugendtheaters. Und weiter: Etwas zu ruhig, etwas zu solide ist es. Entdeckerleidenschaft der Theatermacher scheint im Alltag eingeschlafen. Hier hat sich etwas getan. Wir hatten bei einigen nicht eingeladenen und bei den meisten in Berlin zu sehenden Inszenierungen den Eindruck, dass Grenzüberschreitungen sowohl in ästhetischer Hinsicht, als auch in der Rollenverteilung der Beteiligten stattfinden. Es gibt sie, die experimentierfreudigen Theatermacher in der Kinder- und Jugendtheaterszene, die sich und ihre Möglichkeiten genreübergreifend ausprobieren. So wurden in drei eingeladenen Inszenierungen Prosatexte mit starker Handschrift bearbeitet und für eine Inszenierung verwendet (Fett Frei und Fast Free, Höchste Eisenbahn und I Furiosi Die Wütenden). Mag sein, dass keine dieser Textfassungen übertragbar auf andere Ensembles und Häuser ist, zu sehr leben sie durch eine eigenwillige Gesamtinszenierung. Aber wie reich und vielschichtig wirkt diese theatertauglich gemachte Prosa auf der Bühne! Die Suche nach neuen Stücken für Kinder und Jugendliche ist eine Sysiphusarbeit und immer seltener scheinen Theatermacher fündig zu werden. Stattdessen bearbeiten sie zunehmend genrefremde Werke, Bilderbücher und Themen für ihre eigenen Anliegen. Regisseure werden dabei zu Autoren, die Schauspieler zu Materialsammlern, weil die verlegten (auch die prämierten) Stücke zuweilen den Hang zum Ausgedachten und Verrätselten haben. Das mag Schreibtischtäter überzeugen, Theaterpraktiker und vor allem das jugendliche Publikum wenden sich im Zweifelsfall den Stücken zu, die ihnen einen Bezug zum eigenen Leben ermöglichen. Unübersehbar ist also die Tendenz vieler freier und fester Theater, eigene Stückfassungen zu erstellen. Hier sei als nicht eingeladenes, aber dennoch wegweisendes politisches Themenstück hingewiesen auf Hallo Nazi von Monoblock, das in der Spielpraxis überwältigenden Zuspruch vom jugendlichen Publikum erfährt. Nicht zuletzt deshalb, weil sich Inhalte und Sprache an Ergebnissen einer Recherche orientieren. Verständlich auch der große Erfolg, den norway.today (der Text wurde in Proben mit Schauspielern entwickelt) und Klamms Krieg an deutschen Bühnen erleben. Dramaturgen und Regisseure sind fast dankbar, dass Autoren aktuelle Themen in eine zugleich geformte und junge Sprache gebracht haben, die eine Unterscheidung zwischen U- und E-Kultur erübrigt. Der Einsatz des Mediums Video wird selbstverständlicher und gekonnter in Gesamtkonzeptionen integriert, wie wir in Schnitt ins Fleisch, sowie norway.today sehen können. Hier entwickelt sich ein dem Theater nutzbringender Umgang mit den neuen Medien, der das Spiel auf der Bühne nicht in den Hintergrund drängt, sondern durch Atmosphäre, Kommentierung und Ironie verstärkt. In Feuergesicht erleben wir zur Verfremdung und Verstärkung Elemente der Pop- und Comic-Kultur, die die Kraft der Sprache nicht relativieren, sondern zur vollen Entfaltung bringen. Choreographisches, rhythmisches Arbeiten scheint ebenfalls Fuß zu fassen. Sei es als ausdrücklich eingesetztes Mittel wie in dem Tanztheater-Stück Fett Frei und Fast Free oder wie in I Furiosi Die Wütenden, in dem die Protagonisten Sprache und choreographierte Männlichkeitsrituale mit artistischer Kraft durcheinanderwirbeln, so dass selbst Fußballfans im Publikum die Schnittmenge von Theater und Sport bejubeln. In Cyrano lässt uns die inszenatorische Übersetzung des Krieges mit nur wenigen rennenden Schauspielern staunen eine unverfälschte Theaterübersetzung. Zart und verspielt dagegen die clowneske Körperlichkeit, die uns in den Drei Männern, die nicht sterben wollten begegnet und gerade die jungen Zuschauer spüren lässt, wie nah Alter und Kindheit beieinander liegen. Ein weiterer Aspekt scheint zum Thema Grenzerweiterung zentral zu sein: die Arbeit von Protagonisten als Mitgestalter des inszenatorischen Prozesses. Höchste Eisenbahn lebt von zwei starken Erzählern, die gemeinsam mit der Regie ihre persönliche, den Figuren gemäße Rahmenhandlung gebaut haben, und die mit großer spielerischer Souveränität die Ebenen zwischen Erzählung, Spiel und Spielerei mit der Modellbahnanlage wechseln. Die Objekte der Geschichte beginnen zu leben und treiben die Handlung zu atmosphärischen Höhepunkten, ohne dass sich die Inszenierung als Puppenspiel im herkömmlichen Sinn versteht. Auch hier wieder eine Genreüberschreitung der anregenden Art. Auch bei der Inszenierung I Furiosi Die Wütenden ist es dem Ergebnis auf der Bühne deutlich anzusehen, wie außergewöhnlich intensiv die einzelnen Darsteller am inszenatorischen Prozess beteiligt gewesen sind. Die Aufführung lässt sich nicht denken mit Schauspielern, die ausschließlich tun, was der Regisseur ihnen sagt. In diesen Inszenierungen, die bezeichnenderweise beide Koproduktionen sind, wirkt das Schauspielensemble auf angenehme Weise selbstbewusst und tragend, sein mitgestaltender Einfluss im Probengeschehen spiegelt sich in der Kraft ihrer Präsentation und der Präsenz ihrer Darsteller auf der Bühne. Die Genreüberschreitung scheint zu einem selbstverständlicheren Vorgang zu werden. Vielleicht stammen ihre Impulse nicht immer aus dem Kinder- und Jugendtheaterbereich, sie bereichern diesen aber zunehmend. Es gibt sie: die erfreuliche Entwicklung hin zum Gesamtkunstwerk, in der zuweilen die vertikalen Theaterhierarchien aufgeweicht werden und sich verschiedene Methoden und Einflüsse im cross over zu einem neuen Ganzen formen. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Wie lockt man den Zeitgeist auf die Bühne oder: Gibt es noch eine gemeinsame Realität von Theatermachern und Publikum? |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Zwei Wege konnten wir beobachten, die Theatermacher beschritten haben, um die gemeinsame Realität mit ihrem Publikum zum Gegenstand von Theater zu machen. Der erste Weg führt über neu entstandene Stücke. Das Internet hat die Realität dramatisiert zwei junge Leute verabreden sich im Chatroom zum gemeinsamen Selbstmord. Der Spiegel berichtete über einen authentischen Fall und Igor Bauersima lieferte mit norway.today einen anspruchsvollen Text, der Wege für die Darstellung eines hochaktuellen Themas mit theatralen Mitteln eröffnet. Fiktion reibt sich an der Realität. Dem Stück Klamms Krieg von Kai Hensel erging es umgekehrt. Kurz nach der Uraufführung am Staatsschauspiel Dresden drohte das Stück als dramatisiertes Erklärungsmuster für den Amoklauf von Erfurt benutzt zu werden. Realität reibt sich an der Fiktion. Beide Werke sind bundesweit in vielfacher Umsetzung allerdings in qualitativ sehr divergierenden Inszenierungen im Kinder- und Jugendtheaterspielplan zu sehen. Zwei diskussionswürdige Beispiele stehen in der Auswahl des Treffens für diese aktuelle Entwicklung. Parallel dazu gibt es immer öfter den Versuch, die Realität junger Leute direkt zu transportieren, sie zu Material und Akteur der Bühnengeschichte zu machen. Diese, vielleicht als dokumentierendes Theater zu bezeichnende Form entwickelt ihren Reiz aus der Widerspiegelung theatraler Momente des Alltags beziehungsweise ihrer bewussten Zuspitzung. Einem Dokumentarfilm gleich wird Authentizität vermittelt. Ausschnitte aus der Realität werden in Echtzeit gespielt und gegen- und aneinander montiert. Genau wie Schnitt und Montage die Erzählstruktur eines Films bestimmen, sorgt die Regie mit der Rhythmisierung der Sprache und choreographischem Einsatz der Körper für theatrale Dynamik der Aufführung. Diesem zweiten Weg folgt eine Inszenierung wie I Furiosi Die Wütenden mit beeindruckender Vitalität. Zwei für lebendiges Jugendtheater exemplarische Theatererlebnisse, die wir auf unserer Reise hatten, die aber leider außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und damit außerhalb des Rahmens des Deutschen Kinder- und Jugendtheater-Treffens liegen, dürfen hier nicht unerwähnt bleiben. Der eben beschriebene Weg führte uns schnurstracks in die Schweiz. Hier scheinen die Protagonisten von Jugendtheater jünger und das inhaltliche Panorama breiter, der Blick auf die Realität verwirrender. Ganz bestimmt müssten auch solche einzigartigen Beispiele für innovatives Jugendtheater beim Fachtreffen des deutschen Kinder- und Jugendtheaters einen Platz finden. Ein absolutes Achtungszeichen setzt die Inszenierung Shooting Bourbaki des deutschen Regieteams Helgard Haug, Stefan Kaegi und Daniel Wetzel, die im Auftrag des Luzerner Theaters und der Expo 2002 entstanden ist. Fünf Jungen zwischen 13 und 15 Jahren bieten eine Show zwischen Kindheitstraum, Polizeischießkeller, Videogame, Liedgut und Kriegsgeschichte. Das Regieteam versteht die Jungen als Spezialisten für diese Inhalte, denen mit der Inszenierung ein Podium zur Selbstdarstellung offeriert wird. Gleichzeitig wird die Dynamik, Präsenz und Alltagserfahrung der Spieler für den eigenen Inszenierungsstil der Regisseure genutzt, mit anerkanntem Erfolg. Eine Arbeit, die sich herkömmlicher Einordnung in Begriffe wie Laientheater entzieht und mit hoher inszenatorischer Genauigkeit eine mögliche virtuelle Alltagswelt der Jungen auf die Bühne bringt. Die Aufführungen der auch auf Tour gezeigten Inszenierung konstituieren eine gemeinsame Realität der Beteiligten eben die Bühnenrealität der jeweiligen Vorstellung in Wechselbeziehung mit den Reaktionen des Publikums. Ein lustvolles Lehrstück für Erwachsene. Ähnliches ist am jungen theater basel zu beobachten, dessen Inszenierungen mit jugendlichen Darstellern zunehmend häufiger als Gastspiel auf Festivals der etablierten professionellen Theaterszene auftauchen und gefeiert werden. Lieb mi! ist eine Auftragsarbeit des jungen theaters an den Autor Lukas Holliger zum Thema Liebessehnsucht. Sebastian Nübling inszeniert mit den vier jugendlichen Protagonisten die Realisierung geheimster Wünsche, unbedingte Erfüllung gemäß dem Motto: Küss mich oder schlag mich! Aber mach etwas! Dem gegenüber steht eine erwachsene Figur, die mit ihrer poetischen Geschichte von unerfüllter Liebe Kontakt zur Szene sucht, doch höchstens mit musealem Erstaunen betrachtet wird und schließlich selbst zum Betrachter wird. Hier werden parallel zueinander existierende Realitäten behauptet, Sprach- und Verhaltensmuster gegeneinander gesetzt, denen die Liebessehnsucht aller gemeinsam ist. Einmal mehr scheint die Schweiz einen neuen Impuls im Kinder- und Jugendtheater zu befördern. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Der gemeinsame Markt oder: Was hast Du, was ich nicht hab? |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Wenn von Tendenzen des deutschen Kinder- und Jugendtheaters die Rede ist, sollte eine Erscheinung erwähnt werden, die zum Spiel hinter der Bühne gehört. Gemeint ist die Kooperationspraxis großer Stadt- und Staatstheater mit relativ ungebundenen Protagonisten der Szene. Vielleicht ist es gewagt, von Tendenz zu sprechen. Vielleicht ist es auch ein Zufall der Auswahl zu diesem Treffen, dass mindestens zwei, wenn nicht drei Arbeiten präsentiert werden können, bei denen aus der Not sehr verschiedener Produktionsweisen und Arbeitsbedingungen der Partner die Tugend einer Liaison gemacht wurde. Tendenz oder Zufall eine Möglichkeit wird sichtbar, sich unterschiedlicher Ressourcen für Theaterarbeit gemeinsam zu bedienen. Und die Wunschkinder solcher Vernunftehen können hinreißend sein oder verstörend in jedem Fall gutes Theater. Was bewegt die Partner, es miteinander zu tun? Bei all ihrer Verschiedenheit? Die Unterschiede! Was hast du, was ich nicht habe? Das ist die Frage, die erst einmal mutig weil öffentlich neidvoll gestellt sein will. Ein Mut, der den Hochmut der Abgrenzung überwindet, der die unzeitgemäße Verachtung für den angeblich armen Vetter beiseite schiebt, den Angstphantasien von den angeblich verbeamteten Kollegen der Stadt- und Staatstheater entgegenlacht und den Blick in nüchterner Gier auf Fettpolster und Spannkraft, auf die Gelassenheiten und Ordnungen, auf die Vereinigungspotenziale des jeweils anderen richtet. Geld und Kreativität sind selbstverständlich kein Widerspruch, und wenn die Befreiung vom täglichen Fundraising dem unbezahlbaren Freiraum für Schöpfung von Theater auf der Bühne zugute kommt, ist vieles gewonnen. Straffe Organisation muß im Miteinander lange Entwicklungszeiten nicht ausschliessen, das Risiko beim Scheitern wird überschaubar und bei Erfolg erzielen beide Seiten hohe Gewinne. Ressourcenschonung und -nutzung, Vervielfältigungen der öffentlichen Wirkung, die gegenseitige Neugier auf die Entdeckungsreisewege des Partners erweitern gemeinsame Sehnsucht. Ein Staatstheater zusammen mit einem renommierten Theaterhaus und einer großen Gruppe ganz Freier haben es bewiesen (I Furiosi Die Wütenden), ein Stadttheater mit einem bekannten Puppentheater-Ensemble und einer Spielstätte für Figurentheater (Höchste Eisenbahn) sind Vorbild geworden; und vielleicht darf in gewisser Weise auch die Zusammenarbeit einer Tanztheaterfrau mit einem Schauspielensemble (Fett Frei und Fast Free) dazugerechnet werden. Zufall oder Tendenz? Chancen sind solche Kooperativen auf Zeit! Ob sie auch Gefahren bergen, mag man fragen. Für wen aber, und wofür? Für gutes Theater? Peter Fischer, Ina Kindler-Popp und Franziska Steiof |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Theater für junge Zuschauer in Russland |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Wer schon einmal an einem beliebigen Werktag in Russland im Theater gewesen ist, wird sich an einfach, aber korrekt gekleidete Menschen erinnern und an eine Atmosphäre, die festlich zu nennen nicht übertrieben ist. Die gespannte Erwartung der Zuschauer teilt sich dem fremden Beobachter fast körperlich mit. Die Zuschauer repräsentieren so ziemlich alle Schichten der Bevölkerung. Man begegnet auffällig vielen jungen Menschen, selbst in den Abendvorstellungen sind Kinder unter den Zuschauern. Das Bild ändert sich nicht wesentlich, ist man in einem der über 60 großen Kinder- und Jugendtheater Russlands zu Gast. Zwar überwiegen zweifelsohne junge Zuschauer, wohl treffen sich aber alle Generationen zum Rendezvous mit der Theaterkunst für ein junges Publikum. Das Theater gehört zum Leben dazu. Der Theaterbesuch wird nicht als lästige Pflicht, sondern als notwendiges Lebensmittel begriffen. Und so verstehen auch die Theatermacher ihre Kunst. Sie wollen der Gesellschaft ein Ideal geben. Diesem mit geradezu messiani-schem Pathos vertretenen Anspruch der russischen Theaterkunst steht eine soziale Wirklichkeit gegenüber, die mit den Vokabeln ma-rode und krank nur annähernd beschrieben ist. Die Probleme des Lebens sind schwieriger als die Probleme des Theaters. Doch gerade aus diesem Widerspruch, so scheint es, bezieht das russische Theater seine Überlebenskraft. Das Theater will den Menschen nicht beibringen, wie sie zu leben hätten, aber es erringt die Aufmerksamkeit des Zuschauers, damit er in der Lage ist, gemeinsam mit den Theatermachern die gesellschaftlichen Utopien in der Kunst zu erleben. Damit ändert sich die Wahrnehmung der Zuschauer. Obschon man geneigt sein könnte zu glauben, die Spielweise des psychologischen Realismus, die intensive und bewegende Theatererlebnisse ermöglicht, werde zur bloßen Abbildung von Wirklichkeit benutzt, behaupten die russischen Macher des Theaters für ein junges Publikum energisch die Autonomie der Kunst gegenüber der Realität. Theater brauche den Abstand zu den sozialen Problemen, nur so könne es wirken. Und vielleicht ist ja genau die Frage nach dem Halt an einer Idee die soziale Frage, die sich in Russland heute am dringlichsten stellt. Das Kinder- und Jugendtheater hat in Russland eine große Tradition, doch in Deutschland wissen wir nur wenig über die Eigenart dieser Kunst und Kultur für junge Zuschauer. Dabei wäre es sicherlich auch für deutsche Regisseure, Theaterleiter, Dramaturgen, Schauspieler oder Theaterpädagogen interessant zu erfahren, wie ihre russischen Kollegen arbeiten und welche Ideen sie mit ihrer Kunst verbinden. Deshalb haben wir eine Troika von Aufführungen eingeladen, die in der Ästhetik und den Themen und Stoffen, die sie behandeln, sehr unterschiedlich sind. Gemeinsam ist ihnen die Professionalität der beteiligten Künstler sowie die Eindringlichkeit und Intensität der Theatererlebnisse. Dieses Gastspielprogramm ist ein weiterer Schritt bei der Erprobung von Formen der lebendigen Auseinandersetzung mit der russischen Theaterkultur. Wir wollen das Publikum dieser Troika begleiten und bieten daher interessierten deutschen Zuschauern vielfältige Unterstützung bei der Beschäftigung mit den eingeladenen Inszenierungen an. Diese Begleitung umfasst vor allem Hintergrund-Informationen zum Stück, zum Autor, zum gastierenden Theater und zum Regisseur, zur allgemeinen Situation des Kinder- und Jugendtheaters in Russland und zu den ästhetischen Besonderheiten des russischen Theaters. Und selbstverständlich haben wir auch für geeignete Formen der Übersetzung während der Aufführungen gesorgt. So knüpfen wir an unsere Erfahrungen während der deutsch-russischen Fachtagung im November letzten Jahres in Berlin an und ergänzen den dort umfassend gegebenen Überblick über die Kunst und Kultur des Theaters für ein junges Publikum mit dem Einblick in das leibhaftige Theaterschaffen in Russland. Der direkte Kontakt zwischen deutschen und russischen Künstlern findet während der Aufführungen, in den Inszenierungsgesprächen und natürlich ebenso während des russischen Abends statt. So bieten sich viele Gelegenheiten zu Begegnung und zum Austausch mit unseren russischen Gästen und Kollegen. Und vielleicht machen wir damit Lust auf mehr: Lust auf eine Theaterexkursion nach Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg im Herbst 2003. Lust auf ein Buch über das Kinder- und Jugendtheater in Russland. Oder Lust auf die Buchmesse in Frankfurt am Main, wo Russland in diesem Jahr Gastland sein wird. Dobro poschalowat w Berlin! Gerd Taube |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Festivalpaket Russisches Theater Das Kinder- und Jugendtheater hat in Russland eine große Tradition. In über 60 großen Theatern im ganzen Land ist diese besondere Theaterkunst für ein junges Publikum lebendig. Doch in Deutschland wissen wir nur wenig über die Eigenart dieser Kunst und Kultur für junge Zuschauer. Dabei wäre auch für deutsche Regisseure, Dramaturgen, Schauspieler oder Theaterpädagogen ein Einblick in die Theaterarbeit der russischen Kollegen interessant. Zu Gast bei Augenblick mal! ist eine Troika von Aufführungen, die in der Ästhetik und ihren Themen und Stoffen sehr unterschiedlich sind. Diese Troika möchte zur Begegnung mit der russischen Theaterkultur einladen und bietet unseren Zuschauern rund um die Inszenierungen Informationsforen und Gespräche mit den russischen Künstlern. So knüpfen wir an unsere Erfahrungen während der deutschrussischen Fachtagung im November 2002 in Berlin an und ergänzen den dort umfassend gegebenen Überblick über die Theaterkunst und -kultur für junge Zuschauer mit dem Erlebnis von drei großartigen Inszenierungen aus Russland. Vielleicht machen wir damit Lust auf mehr: auf eine Theaterexkursion nach Russland im Herbst 2003, auf ein Buch über das Kinder- und Jugendtheater in Russland oder auf die Buchmesse in Frankfurt am Main, wo Russland in diesem Jahr Gastland sein wird. Interessierte an diesem Gastschwerpunkt können das Festivalpaket Russisches Theater buchen! (Infos unter |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Für Kinder und Jugendliche schafft Augenblick mal! im carrousel Theater einen Raum Kinder Stimmen Jugendliche Meinungen, in dem Reaktionen und Ideen zu den Theateraufführungen geäußert werden können, mit Stift und Papier, mit Kamera und Mikro, mit dem Internet als Quelle zusätzlicher Informationen. Lehrer oder andere Interessierte, die mit einer Gruppe das Angebot nutzen wollen, können sich an das Festivalbüro wenden. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Theaterpädagogische Projekte, Diskussionen und Beiträge von Kindern und Jugendlichen in einer Ausstellung Konzeption: Gabi dan Droste, Annett Israel, Ilona Sauer Kinder und Öffentlichkeit Eine Gruppe von Kindern verschiedenen Alters zieht durch die Straßen der Stadt und spielt Verstecken, Fang den Ball usw. wer kennt dieses Bild nicht; es war Bestandteil des öffentlichen Lebens. Es zeigte selbstbestimmte Kinder, die unabhängig von der Erwachsenenwelt ihre eigenen Regeln aufstellten, in der Gemeinschaft stark waren und sich ihr Leben draußen eroberten. Das Erscheinungsbild von Kindern in der Öffentlichkeit heute ist einem starken Veränderungsprozess unterworfen. Kinder spielen und agieren weniger denn je im Freien, in unkontrollierten Aktionsfeldern. Kinderspiele finden verstärkt in geschlossenen Räumen statt, die dem Blick der Öffentlichkeit entzogen sind. Aus heterogenen Kindergesellschaften im öffentlichen Raum sind sporadisch auftretende, homogene Kleingruppen geworden zumeist bestehend aus Jungen , die sich treffen, um sportlichen Vorlieben wie Skateboarding, Basket- und Fußball nachzugehen. Kinderöffentlichkeit Demgegenüber stehen seit den siebziger Jahren Projekte in der Tradition der offenen Arbeit mit Heranwachsenden, die dem Verschwinden von Kindern aus dem öffentlichen Bewusstsein entgegenwirken und ihnen einen Freiraum für eigene Entfaltung und Meinungsäußerung geben. Auch an Theatern finden sich immer wieder Beispiele, die die Idee einer Kinderöffentlichkeit in ihre Arbeit integrieren und deren Ziele verfolgen. So initiierte beispielsweise das Thalia Theater Halle letztes Jahr die Kinderstadt halle an der salle als Partizipationsprojekt, bei dem Kinder ihre eigene Stadt entwarfen und über deren Aussehen, Struktur und Aufbau selbst entschieden. Das FUNDUS-Theater Hamburg erforscht seit Jahren kindliche Sicht-weisen und Belange und gründete 1992 den Verein PROFUND Kinder-theater e.V.. Es entstand das Perfor-mance-Projekt Schuluhr und Zeitmaschine von Sibylle Peters, bei dem ein Dokumentarfilmer die Arbeit mit Schülern zum Theater-thema aufzeichnet und das ge-wonnene Filmmaterial in die Theateraufführung integriert. Kinder Öffentlichkeit und Theater? In Anbetracht dieser Beispiele und der gesellschaftlichen Entwicklung stellt sich eine Reihe von Fragen: Ist die Idee einer Kinderöffentlichkeit eine Idee von gestern? Soll eine theaterpädagogische Arbeit diese überhaupt verfolgen? Welche Chancen und Grenzen liegen hier generell verborgen und insbesondere innerhalb der Struktur eines Theaters? Wird der Theaterpädagoge hier als Sprachrohr der Kinder dienen, als Mittler zwischen Rezipient und Produzent? Ist dies eine originäre Chance oder seine Degradierung? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des diesjährigen theaterpädagogi-schen Fachforums. Die zwei genann-ten Theater sind eingeladen worden, ihre Arbeiten in Form einer Ausstellung exemplarisch zu zeigen. Diese Präsentation wie auch die ebenfalls ausgestellten Arbeiten der Patenklassen und Medienprojekte sollen einen Einblick in die Thematik eröffnen und Eckpunkte einer möglichen Diskussion über die Ziele, Chancen und Grenzen innerhalb einer theaterpädagogischen Arbeit an einem Theater markieren. Kinder begleiten Theater Beim diesjährigen Treffen werden Berliner Kinder und Jugendliche als Patenklassen zu ausgewählten Inszenierungen arbeiten und die entstehenden Arbeiten in einer Ausstellung im carrousel Theater vorstellen. Fluchtwege, Hans Otto Theater Potsdam: Anknüpfungspunkt für die Projektleiterinnen Anne Swoboda (Theater Siebenschuh) und Manuela Gerlach (Hans Otto Theater Potsdam) ist der Koffer, ein Requisit der Inszenierung. Ausgehend von Idee und Bild des Koffers werden Schüler einer 3. Klasse der Lenau-Schule aus Kreuzberg arbeiten, die von Kindern aus zwölf verschiedenen Nationen besucht wird. Ein Briefaustausch der Kinder mit den Potsdamer Schauspielern wird auf den Webseiten des Kinder- und Jugendtheater-Treffens veröffentlicht. Am Ende steht eine Ausstel-lung von 27 Koffern und den Fotos der Kinder in ihrer persönlichen Auseinandersetzung mit dem Stoff. norway.today, Städtische Bühnen Münster, Junges Theater: Eine Gruppe Jugendlicher thematisiert unter der Leitung von Stephan Hoffmann (carrousel Theater an der Parkaue) und Thurit Kremer (Schlesische 27) die Inszenierung auf der Basis einer Auseinandersetzung mit dem Thema warum es sich zu leben lohnt. Anknüpfend an die medialen Szenen der Inszenierung werden sie ihre Gedanken filmisch umsetzen und als Video präsentieren. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Beim diesjährigen Treffen werden Berliner Kinder und Jugendliche als Patenklassen zu ausgewählten Inszenierungen arbeiten und die entstehenden Arbeiten in einer Ausstellung im carrousel Theater vorstellen. Fluchtwege, Hans Otto Theater Potsdam: Anknüpfungspunkt für die Projektleiterinnen Anne Swoboda (Theater Siebenschuh) und Manuela Gerlach (Hans Otto Theater Potsdam) ist der Koffer, ein Requisit der Inszenierung. Ausgehend von Idee und Bild des Koffers werden Schüler einer 3. Klasse der Lenau-Schule aus Kreuzberg arbeiten, die von Kindern aus zwölf verschiedenen Nationen besucht wird. Ein Briefaustausch der Kinder mit den Potsdamer Schauspielern wird auf den Webseiten des Kinder- und Jugendtheater-Treffens veröffentlicht. Am Ende steht eine Ausstellung von 27 Koffern und den Fotos der Kinder in ihrer persönlichen Auseinandersetzung mit dem Stoff (carrousel Theater, Foyer). Bitte beachten Sie dazu auch den Internet-Auftritt der Lenau-Schule Um zu o.g. Projekt zu gelangen, klicken sie auf derHomepage zunächst auf Enter, dann auf Aktuelles und von dort auf Aus den einzelnen Klassen. Unter der Klasse 3a finden Sie den Unterpunkt Fluchtwege! |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Veranstaltungen |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fachreferenten des Goethe-Institutes, Theatermacher des freien Kinder- und Jugendtheaters und des Puppen- und Figurentheaters, Schauspielstudierende, Theaterpädagogen und Journalisten treffen sich bei Augenblick mal! in verschiedenen Diskussionsforen und Workshops. Diese speziellen Foren sind nicht öffentlich. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Inszenierungsgespräche Ästhetische Standpunkte und künstlerische Blickwinkel Fachgespräche - nicht nur für Fachleute Im Kinder- und Jugendtheater muss die ästhetische Diskussion geführt werden. Die Diskussion von Kunstwerken des Kinder- und Jugendtheaters darf sich nicht darin erschöpfen, sich auszutauschen, ob man eine gute oder eine schlechte Aufführung gesehen hat. Ein selbstbewusstes Kinder- und Jugendtheater muss sich mit seiner Ästhetik und deren Aktualität kritisch auseinandersetzen. Außerdem ist ein sich selbst und seines ästhetischen Potenzials bewusstes Kinder- und Jugendtheater ein starkes kulturpolitisches Argument seiner selbst. Die zehn ausgewählten Inszenierungen des 7. Deutschen Kinder- und Jugendtheater-Treffens sollen Gegenstand einer solchen Diskussion sein. Aus verschiedenen Blickwinkeln, mit den unterschiedlichen Standpunkten und unter wechselnden Gesichtspunkten diskutieren Zuschauer und an den Inszenierungen beteiligte Künstler die Stücke und Aufführungen. Durch die analytische Fokussierung der Aspekte für die Diskussion in drei Diskussionsrunden, die jeweils dieselben Stücke zum Gegenstand haben, kann der traditionellen Hierarchisierung der Theatermittel auch auf der Reflexionsebene entgegengewirkt werden. Der jeweilige ästhetische Eigenwert der Systeme Darstellungskunst, Dramatik und Raum kann durch diese Methode betont und hervorgehoben, ihre Funktionen im Gesamtgefüge der Aufführung besser erfasst werden. Konzeption: Henning Fangauf |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Veranstaltungen |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begegnungs- und Arbeitsforen |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Studentenforum Schauspiel. Kunst für Kinder Ganz sicher ist das Kindertheater nicht weniger künstlerisch als das gewöhnliche Theater. Es vermittelt nicht reduziertes Theater, das speziell für ein junges Publikum von den Höhen der Kunst heruntergekommen ist , und es bereitet nicht einfach auf das eigentliche Theater vor. Das andere an diesem Theater, das ist sein Zuschauer. Während die Künstler in jenem Theater, das Erwachsene für Erwachsene spielen, darauf vertrauen können, das annähernd gleiche Erfahrungen beim Publikum vorhanden sind, ist dieser Abstand im Kindertheater groß. Die Theaterkonvention, Du spielst mir etwas vor, ich schaue dir stillschweigend zu, haben Kinder nicht verinnerlicht. So wird kaum ein Kind brav auf seinem Sitzplatz ausharren, wenn das Bühnengeschehen es nichts angeht. Denn hier wird mitgespielt! Und so manches Mal entsteht dann im Zuschauersaal die von den Bühnenakteuren gefürchtete Schulhofstimmung. Kinder spielen. Schauspieler spielen. In dieser Verwandtschaft liegt die Chance, sich im Schutze des Als ob als Partner zu begegnen. Doch dieses Zusammenspiel hat eine Voraussetzung: Es ist jene Haltung, in der die Künstler weder vorm unschuldigen Kind in die Knie gehen, noch sich darüber erheben, weil sie noch unfertige Menschen vor sich glauben. Denn keinesfalls geht es darum, die Kunst an das vermeintliche Niveau des jungen Publikums anzupassen, sondern mit ihm in einen Dialog zu treten. Auf der Suche nach diesem gemeinsamen Erlebnis haben Theaterkünstler Spielweisen, Formen und Stile erprobt, die den imaginierenden Zuschauer als Mitschöpfer ihrer künstlerischen Arbeit ernst nehmen. Sie haben Erzählweisen gefunden, mit denen sie Kinder erreichen und die das Mit-Teilen möglich machen. Es sind Spielweisen, die sich unmittelbar und direkt, und ohne die vierte Wand gegen das Parkett aufzurichten, an das Publikum wenden. Es ist ein Theater, das seine Geschichten, auch die großen Mythen und klassischen Stoffe aus der Perspektive des Kindes erzählt. Es sind Darstellungsformen, die mitunter an jene anknüpfen, die die Jüngsten in ihren geselligen Spielen hervorbringen. Das Studentenforum wendet sich in diesem Jahr und das ist ein Novum an eine Gruppe von Schauspielstudierenden. Ausgehend von den auf dem Festival präsentierten Inszenierungen für ein Kinderpublikum werden sie sich ganz praktisch mit den Besonderheiten dieser Kunst auseinandersetzen. Die Leitung des Workshops hat die Regisseurin Greet Vissers übernommen, die 1992 mit Jo Roets im belgischen Antwerpen das renommierte Kinder- und Jugendtheater Blauw Vier gegründet hatte und hier mit ihren Inszenierungen Fu-rore machte. Hierzulande ist sie zunächst als Mitautorin der viel gespielten Neufassung des Cyrano oder die beim Festival Schöne Aussicht im letzten Jahr gezeigten deutsche Aufführung von Ein Lied für die Sonne von Cantecleir bekannt geworden ist. Auf dem 7. Deutschen Kinder- und Jugend- theater-Treffen zeigt das Rheinische Landestheater Neuss ihre Regiearbeit Von drei alten Männern, die nicht sterben wollten. Kindertheater zu machen heißt für sie, mit den Schauspielern eine direkte Spielweise zu finden und die Geschichte mitten in die Lebenswelt der Kinder zu stellen. Am Beispiel der gezeigten Inszenierungen für Kinder wird sie das mit den Studierenden spielerisch untersuchen und dabei insbesondere auf den Unterschied zwischen psycho-logischem und epischem Theater, auf offene Spielweisen in der Bewegungs- und Bildsprache und die Kraft der Metaphern eingehen. In einer Diskussion haben die Studie-renden darüber hinaus Gelegenheit, mit der Regisseurin und Jurorin Franziska Steiof und weiteren Regisseuren des Jugendtheaters über aktuelle Tendenzen im Jugendtheater zu sprechen und die gesehenen Aufführungen zu reflektieren. Hochschule für Theater und Musik Zürich, Departement Theater, Studiengang IV, Bereich Darstellende Kunst |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Forum Goethe-Institut geschlossene Veranstaltung Mittlerweile ist es fast schon zu einem festen Bestandteil des Kinder- und Jugendtheatertreffens geworden, die Fortbildung des Goethe-Instituts. Auch in diesem Jahr nehmen wieder Institutsleiter und Referenten von Goethe-Instituten aus allen fünf Kontinenten daran teil. Die Veranstaltung wird geleitet von Chris Meuer und Thomas Stumpp |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Im Rückblick wird das Bild des Theaters entscheidend von dem Blick der Theaterfotografen mitgeprägt. Ergänzend zu dem traditionellen Blick auf die einzelnen Szenen der Aufführung fotografiert der Berliner Theaterfotograf Jörg Metzner die Figuren und Spieler der deutschen Gastspiele. Wie in den vergangenen Jahren wird der Schwebezustand der Akteure zwi-schen der Theaterrolle und der alltäglichen Rolle des Schauspielers eingefangen. Dazu entstehen Rollenportraits, um beispielsweise unter dem Stichwort Helden wie ihr! die Charaktere des Kinder- und Jugendtheaters einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Schließlich veranschaulichen Gruppenaufnahmen der Figuren jeder Inszenierung den Zusammenhang der jeweiligen Rollenkonstellation als Familie. Pressefotos und Audiomitschnitte komplettieren die Sammlung von Eindrücken vom 7. Deutschen Kinder- und Jugendtheater-Treffen in Berlin als Beleg und Illustration publizistischer bzw. medialer Annäherungen an das zeitgenössische Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. Hierzu werden in diesem Sommer auch die vorliegenden Quellen zum Fotoarchiv des Deutschen Kinder- und Jugendtheater-Treffens gesichert und zugänglich gemacht; diese Bilddokumentation kann künftig wie die anderen Erwerbungen der Sammlung des Zentrums auch unter www.kjtz.de abgefragt werden. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| Theater im Netz |
|
||||||||||||||||||||||||||
| www.augenblickmal.de Zeitgleich mit dem Erscheinen von Erstinformation und Programmheft werden die Informationen zum 7. Deutschen Kinder- und Jugendtheater-Treffen auch ins WorldWideWeb gestellt. Detaillierte Übersichten zu den Gastspielen und dem Rahmenprogramm sowie weitere Hinweise auf Spielorte (mit Stadtplänen) u.a. erleichtern den Besuchern des Treffens die Orientierung. Mit aktuellen Hinweisen, täglichen Live-Berichten und Auszügen aus dem Medienecho wird das Treffen bis Juni 2003 begleitet. Erste Eindrücke können im Gästebuch notiert werden, das Webforum regt zur Fachdiskussion an. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| jugendtheater.net Die Webadresse des 7. Deutschen Kinder- und Jugendtheater-Treffens ist eingebettet in das Portal zum Kinder- und Jugendtheater jugendtheater.net. Die aktuellen Information rund um dieses Ereignis können damit als wesentlicher Teil der Landschaft für Kinder- und Jugendkultur wahrgenommen werden. Nicht nur auf die Dokumentation der vorangegangen Treffen 1999 und 2001, sondern auch auf thematische Beiträge und Links kann der Leser dieser Webpublikation zugreifen. Figuren des Kinder- und Jugendtheaters können demnächst als Ecards verschickt werden; Anschluss an das Berliner Treffen wird ein multimedialer Werkzeugkasten zur spielerischen und reflexiven Beschäftigung mit dem Phänomen Theater anregen. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Auch in diesem Jahr erscheint wieder der Augenfüßler die Zeitung zum Kinder- und Jugendtheater-Treffen. Unter Anleitung der Theaterpädagogen des carrousel Theaters wird täglich eine Ausgabe herausgebracht, die von Berliner Schülerinnen und Schülern produziert wird. Die 15- bis 20jährigen Jugendlichen beobachten das Festival und halten in Texten, Fotos und Zeichnungen ihre Meinungen und Reaktionen auf die Theateraufführungen, Diskussionen und Begegnungsforen des Festivals fest. Sie führen Interviews mit Zuschauern und Theatermachern und werfen einen Blick hinter die Kulissen des Festivals. Das Redaktionsbüro befindet sich in der spielbühne des carrousel Theaters und ist erreichbar unter Tel.: 46 und -47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
im spannenden Dreieck von Theater, Jugend und Medien |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5-Minuten-Theater Schreibwettbewerb für Jugendliche ab 18 Jahren Bewegt dich ein politisches oder soziales Thema und willst du, dass auch andere darüber nachdenken? Kannst du dir vorstellen, dieses Thema auf die Bühne zu bringen? Mache ein Minidrama daraus! Der Schreibwettbewerb im Internet richtet sich an alle zwischen 18 und 25 Jahren, die Lust auf Theater und Politik haben. Nach dem Einsendeschluss am 18. April 2003 entscheiden die fluter-Leserinnen und Leser über den Publikumspreis; eine Fachjury Stefan Fischer-Fels (GRIPS Theater), Antje Rávic Strubel (Autorin), Stephanie Wurster (fluter.de-Redaktion), Dr. Jürgen Kirschner (KJTZ) und Arne Mutert (Bundeszentrale für politische Bildung) vergibt den Jurypreis. Die jeweiligen Hauptgewinner fahren vom 3. bis 5. Mai 2003 zum 7. Deutschen Kinder- und Jugendtheater-Treffen nach Berlin! www.fluter.de Drei Veranstaltungen Drei unterschiedliche Themenstellungen, Altersgruppen und Organisationsformen im spannenden Dreieck von Theater, Jugend und Medien |
|
||||||||||||||||||||||||||
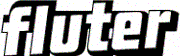 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Electriquelounge Medienwerkstatt für Jugendliche ab 16 Jahren Wie erlebt ihr das 7. Deutsches Kinder- und Jugendtheater-Treffen von der Eröffnung bis zu den deutschen Aufführungen und den Gastspielen aus Russland? Wie könnt ihr eure Eindrücke mit Kamera und Tonband festhalten und multimedial weiter-geben? Vom 3. bis 5. Mai bietet Electriquelounge für Jugendliche ab 16 Jahren eine mediale Begleitung des Treffens an. Nach einer Einführung zum Umgang mit digitaler Kamera und Mini-Disc-Recorder nehmen die Jugendlichen paarweise an Veran-staltungen teil und bereiten an-schließend ihre Aufnahmen multimedial auf. Nach einer internen Sichtung werden die Ergebnisse öffentlich beim Treffen, ab Mitte Mai unter www.electriquelounge.de und später auch im Mixed Media-Bereich von www.augenblickmal.de präsentiert. In Zusammenarbeit mit Mixtour dem Medienmobil der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen e.V., Chemnitz www.AGJF-Sachsen.de Drei Veranstaltungen Drei unterschiedliche Themenstellungen, Altersgruppen und Organisationsformen im spannenden Dreieck von Theater, Jugend und Medien |
|
||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Theater-Chat Theaterspiel im Netz für Jugendliche ab 12 Jahren Cyrano liebt Roxane. Roxane erhält wunderschöne Liebesbriefe von Christian die Cyrano geschrieben hat Was passiert, wenn Theaterfiguren und Theatergeschichten im Chat-Room landen? Am 6. und 7. März 2003 können Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren in Theaterfiguren schlüpfen und Begegnungen mit den anderen Spielern und dem Publikum in der virtuellen Welt ausprobieren. Die Jugendchat-Community CYBER- LAND www.virtuellewelt.de bietet von Ende April bis Juni spezielle Figuren und Räume rund um die Gastspiele des 7. Deutschen Kinder- und Jugendtheater-Treffens auf einer festen Zeitschiene an. Drei Veranstaltungen Drei unterschiedliche Themenstellungen, Altersgruppen und Organisationsformen im spannenden Dreieck von Theater, Jugend und Medien In Zusammenarbeit mit dem wannseeFORUM, Wannseeheim für Jugendarbeit e.V., Berlin, und unter Mitarbeit von Andreas Horbelt, M. A. www.wannseeforum.de |
|
||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Die Texte und Fotos wurden, soweit nicht anders vermerkt, von den beteiligten Ensembles zur Verfügung gestellt. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| |
||

|
||
|
[ Nach oben ] |